Für das Buch „Argumente – Politikvorschläge für Thüringen“ (Hrsg. Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung, Mai 2011) habe ich folgenden Beitrag verfasst:
1. Die Ursachen der Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise
Die Ursachen und Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise werden noch Gegenstand vieler Dissertationen und Forschungsarbeiten sein. Es gilt das Eisberg-Prinzip: Den Teil über dem Wasser haben wir bereits gesehen, doch niemand weiß, wie viel noch unterhalb der Oberfläche liegt. Der Ausgangspunkt der Krise waren die Verwerfungen auf dem amerikanischen Subprime-Markt. Sie führten zu der bisher schwersten Krise des weltweiten Finanz(markt)systems, eine Krise, die nach den Erhebungen und Einschätzungen von Institutionen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Bundesbank vor allem für die europäischen Banken, noch nicht ausgestanden ist. Diese Krise zog einen gewaltigen Konjunkturabschwung und damit besonders für die Industriestaaten eine harte Wirtschaftskrise nach sich. Das jüngste Gewand dieser Krise ist die Refinanzierungskrise ganzer Staaten: Innerhalb der EU waren es bisher Griechenland, Irland und Portugal. Derzeit stehen sogar die Vereinigten Staaten von Amerika auf der Beobachtungsliste der Rating-Agenturen – Tendenz negativ. Ein solcher Befund wäre noch vor wenigen Jahren unvorstellbarer gewesen.
Zu dem prägenden Umfeld der Krisen zählen mehrere Faktoren. Dazu gehören erstens die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den Industriestaaten untereinander sowie zwischen den Industriestaaten und den Schwellenländern. Das prominenteste Beispiel sind die Devisen- und Handelsbeziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten. Seit Jahren schon dreht sich eine Abhängigkeitsspirale: Vereinfacht ausgedrückt, stehen den enormen Überschüssen in der Außenhandelsbilanz Chinas entsprechende Defizite in den Vereinigten Staaten (aber auch in Europa) gegenüber. Die Folge: Die chinesische Staatsbank verfügt über Devisenreserven in Höhe von rund 3 Billionen Dollar, überwiegend angelegt in amerikanischen Anleihen.
Zweitens haben die amerikanische Zentralbank FED sowie andere Zentralbanken ihre Leitzinsen in den vergangenen Jahren auf sehr niedrigem Niveau gehalten. Um Wirtschaftswachstum zu erzeugen, haben sie die Märkte auf Pump mit billigem Geld regelrecht geflutet.
Drittens wurde die Wachstums- und Wohlstandsdefinition in den westlichen Industrieländern auf die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) eingeengt. Um die Kosten zu senken, haben viele europäische und amerikanische Unternehmen die Produktion von Gütern ins Ausland verlagert. So wurden China und Indien zu den „Produktionsstätten der Welt“. Hält diese Entwicklung an, drohen sich die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte weiter zu verstärken. Das Resultat wären erhebliche Wohlstandsverschiebungen in allen beteiligten Staaten – die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich in vielen Entwicklungsländern wie in den G8-Staaten gleichermaßen.
Zum internationalen Umfeld gehört viertens aber auch eine politische Dimension: Alle Regierungen der G8-, aber auch der G20-Staaten wollen möglichst breite Schichten ihrer Bevölkerungen an Wachstum und Wohlstand teilhaben lassen. Genau deshalb geht die Entwicklung auf dem amerikanischen Subprime-Markt nicht nur auf die Gier nach Rendite einiger Investment-Banken zurück, sondern war auch politisch gewollt: Jeder amerikanische Bürger sollte ein Eigenheim besitzen können. Gleichzeitig nahm sich der Staat bei der Regulierung und der Aufsicht von Märkten immer mehr zurück. Bereits die Ankündigung von Wirtschaft und Industrie, Produktionsstätten und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, mündete in einer immer stärkeren Liberalisierung von Marktregeln und staatlichen Anreizsystemen, besonders für den Finanzsektor. So führte der unregulierte Subprime-Markt durch den Mechanismus der Verbriefung und Streuung von Kreditrisiken zur Generierung von strukturierten Wertpapieren, die nicht einmal mehr die Marktteilnehmer verstanden.
Der plötzlich auftretende immense Abschreibungsbedarf führte zu einem Misstrauen der Banken untereinander und am Interbankenmarkt; die internationalen Geldflüsse trockneten aus. An diesem Punkt wurde die Finanzmarktkrise zur Wirtschaftskrise. Die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft: Sie trat der Wirtschaftskrise mit viel Geld entgegen und ließ sich damit auf das Spiel der Märkte zu deren Regeln ein. Weitsicht, neue Ideen und engagierte, mutige Vorstöße wie noch im Rahmen des G20-Gipfels in Pittsburgh verabredet, bleiben mehr und mehr auf der Strecke – bis heute. Dies wiederum trieb Staaten wie Griechenland oder Irland in eine Staatsfinanzierungskrise. Die Märkte trauen der Politik nicht mehr.
2. Eine Renaissance des „Wissen-Wollens“
Als die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 ausbrach, standen die politischen Entscheidungsträger vor einem grundlegenden Problem: Wen konnten sie um Rat fragen? Wer war in der Lage, die internationalen Verflechtungen an den Verbriefungs- und Derivatemärkten sowie im Interbankenverkehr zu erörtern? Auf welche Prognosen und Einschätzungen konnte man sich verlassen? Hinzu kam der enorme Zeitdruck: In nur einer Woche beschloss der Bundestag im September 2008 das Finanzmarktstabilisierungsgesetz und führte den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) ein. Oder nehmen wir ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Der im Mai und Juni 2010 quasi über Nacht ins Leben gerufene europäische Stabilitäts-Mechanismus (ESM, bekannt geworden als „Euro-Rettungsschirm“) geht zurück auf eine Telefonschaltkonferenz der G8-Aufsichtsbehörden. Auf zahlreiche Nachfragen hin erhielten deutsche Bundestagsabgeordnete die Auskunft, harte Daten über tagesaktuelle Entwicklungen auf den Kapital- und Interbankenmärkten hätten damals, an dem Freitag der Schaltkonferenz, gar nicht vorgelegen. Es habe lediglich „gewisse Befürchtungen“ gegeben. In normalen Zeiten wären solche Informationen nicht annähernd ausreichend, um politische Entscheidungen dieser Tragweite treffen zu können!
Nun rächte sich, dass die Politik sich zu wenig mit den internationalen Finanz- und Kapitalmärkten sowie mit deren Akteuren und Produkten auseinandergesetzt hatte. Alle Staaten müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass die politischen Entscheidungsträger oft nicht über das nötige Wissen verfügten, um Verflechtungen und Aktivitäten der Finanzbranche verstehen zu können und dass viele Institutionen nebeneinander her statt miteinander arbeiteten. Die EU-Kommission etwa war keinesfalls unproduktiv, was die Regulierung der Finanz-und Kapitalmärkte angeht – im politischen Alltag gingen diese Vorschläge meist unter. Auch die Diskussionen über den Finanzmarktregelungskatalog „Basel II“ hat die Politik zu wenig begleitet – sie wurden im Baseler Ausschuss hauptsächlich von Aufsichtsbehörden geführt. Die internationalen Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen (IFRS) erarbeitete ein privatrechtlich organisierter Verein in London. Dessen Vorlage wurde ohne richtige Mitwirkung und Kontrolle durch Regierungen und Parlamente ins europäische Recht übernommen. Entsprechend schwierig ist es, diese Regulierungskataloge heute wieder zu ändern.
Eine erste wichtige Konsequenz aus der Krise sollte deshalb eine „Renaissance des WissenWollens“ sein: Die Sprachlosigkeit zwischen Märkten und Politik, zwischen Finanzmarktakteuren und Entscheidungsträgern muss endlich beendet werden.
3. Mit welchem Instrumentenkasten vermeiden wir künftige Krisen?
Im Verlauf der Finanzmarktkrise zogen sich nahezu alle Aufsichtsbehörden, aber auch Wirtschaftsprüfungsunternehmen und andere Akteure des Finanzsektors auf die Position zurück, die Krise sei nicht vorhersehbar gewesen. Im Übrigen hätten sich alle Geschehnisse im Rahmen der geltenden Rechts- und Gesetzeslage bewegt. Das mag stimmen. So mussten zum damaligen Zeitpunkt Banken – gemäß Basel II – Zweckgesellschaften tatsächlich nicht in der Bilanz aufführen. Allerdings offenbart diese Argumentation ein weiteres drastisches Defizit: Jenseits der Aufsicht über bestehende Rechtsnormen und Gesetze braucht es dringend ein Frühwarnsystem und endlich wieder verantwortungsvolles, anständiges Verhalten in den Vorstandsetagen. Nicht alles, was nicht verboten ist, ist automatisch erlaubt. Und nicht alles, was erlaubt ist, ist erwünscht.
Im September 2008 intervenierte der Bund inmitten der Krise mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz. Dieses rief quasi über Nacht den Finanzmarktstabilisierungsfonds SoFFin ins Leben, ausgestattet mit der Befugnis, Garantien zu vergeben, Banken zu rekapitalisieren und toxische, also hoch defizitäre Wertpapiere anzukaufen. Das Volumen betrug 480 Milliarden Euro, weit mehr als der jährliche Bundeshaushalt. Durch die dramatischen Entwicklungen bei der Hypo Real Estate (HRE) wurde im März 2009 ein Ergänzungsgesetz notwendig, um dem Staat die nötigen Instrumente an die Hand zu geben, auch operativ auf eine Bank Einfluss zu nehmen. Das Handels-, Gesellschafts- und Aktienrecht wurde verändert und ergänzt um die Möglichkeit der Verstaatlichung, die bis zum 30. Juni 2009 Bestand hatte. Dieses Instrument, das in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien übrigens schon lange existiert, führte in Deutschland zu erheblichen parlamentarischen Grundsatzdiskussionen und Auseinandersetzungen. Im Juni 2009 mussten wir das Gesetz erneut durch ein Fortentwicklungsgesetz ergänzen: Wir schufen die Möglichkeit von „Bad Banks“, sprich Abwicklungsbanken für faule Kredite und verlustreiche Wertpapiere. Dies geschah auf erheblichen Druck der Branche. Sogar die Deutsche Bundesbank vertrat öffentlich die Auffassung, die Banken würden diese Möglichkeit gewiss in Anspruch nehmen. Jedoch: Aus Angst vor einem Prestigeverlust traute sich kein Institut, die Hilfe anzunehmen mit Ausnahme der WestLB und der HRE, die zum damaligen Zeitpunkt bereits in öffentlicher Hand waren.
Es fehlen aber nicht nur Instrumente für einen Einstieg des Staates in gefährdete Banken im Krisenfall, sondern erst recht für einen klar definierten Ausstieg. Diese Notwendigkeit einer Exit-Strategie wurde im Rahmen der G20 und der Notenbankengouverneure von Beginn der Krise an immer wieder betont und diskutiert.
Auch auf europäischer Ebene besteht ein Defizit, was die Instrumente betrifft. Das hat nicht zuletzt die Verschuldungskrise in den südeuropäischen Ländern und der politische Streit um den Euro-Stabilitätsmechanismus ESM gezeigt. Die Hilfsmaßnahmen ersetzen private Gläubigertitel durch solche, die der ESM und damit die öffentliche Hand hält. Damit wird der Gewinn der Investoren gesichert und das Risiko in die Hände der Steuerzahler gelegt. Es gibt aber keine verbindlichen Vorschriften zur Gläubigerbeteiligung – obwohl die Staaten doch für eben dieses Risiko Zinsen zahlen. Es gibt keine hinreichenden Ansätze für Wachstumsförderungsprogramme in Griechenland oder Irland, obwohl nur durch solides Wirtschaftswachstum die Staatseinnahmen zu generieren sind, die ein Staat braucht, um wieder auf eigenen Füßen stehen zu können. Eine fast schon irrationale Furcht vor weiteren Verlusten im Bankensystem, die auch die Europäische Zentralbank mantra-artig vor sich herträgt, verhindert jeden nachhaltigen Lösungsansatz. Weshalb, muss man fragen, darf eigentlich keine Bank Pleite gehen? Die Gelder der kleinen Leute, die Einlagen und Sparbriefe, wären jedenfalls geschützt.
Beim geplanten permanenten Euro-Rettungsschirm, der im Juli 2013 eingeführt werden soll, werden diese grundsätzlichen Probleme wiederholt: Wieder wird Geld gegen Defizite gesetzt, wieder bleiben die langfristigen Fragen ungelöst. Weshalb sollten Investoren den EuroStaaten und ihren Regierungen nun stärker trauen als zuvor? Ein Minimalkompromiss – von fast allen namhaften Ökonomen kritisiert und selbst von der Bundesbank mehr als kritisch gesehen – soll Europa retten und künftige Krisen vermeiden, zumindest abmildern. Das kann nicht gut gehen!
4. Ein neues Bewusstsein für einen starken Staat und neuer Mut zur Ehrlichkeit
Als die Finanzkrise ausbrach, trafen zwei weitgehend verhärtete Fronten aufeinander. Aus Sicht vieler Wirtschaftsakteure war ein starker Staat der Feind; aus Sicht vieler Politiker war der Feind hingegen ein liberalisierter und unregulierter Markt. Solche verfestigten, vorurteils-beladenen Positionen führen nicht weiter. Wir müssen uns auf die Kernfunktionen von Markt und Staat besinnen: Aus Sicht des Staates ist ein allgemeiner, verbindlicher und verlässlicher Rechtsrahmen notwendig, in dem sich Unternehmen bewegen dürfen. Dabei braucht es auch Raum für Innovationen: Verbriefungsmodelle, die Streuung von Risiken, eine gewisse Freiheit des Derivatemarktes und so weiter. Denn all diese Instrumente sichern den breiten Zugang von Unternehmen zum Kapitalmarkt, der auch in Europa nicht länger allein über die Banken laufen darf. Die angloamerikanischen Staaten sind hier wesentlich weiter. Zugleich dürfen wir nicht hinnehmen, dass Finanzmarktakteure von eingegangenen Risiken befreit werden. Stattdessen geht es um den hinreichenden Selbstbehalt für Risiken, eine stärkere Eigenkapitalunterlegung sowie eine systematisierte Risikovorsorge auf Seiten der Banken und Investoren.
Seit langem wissen wir, dass der deutsche Bankenmarkt dringend konsolidiert werden muss; Deutschland ist „overbanked“. Dennoch versuchen wir, jede Insolvenz einer Bank politisch zu verhindern. Aber damit signalisieren wir der Branche, dass ein „Weiter so“ möglich sei, da am Ende des Tages ja ohnehin der Staat eingreife! In Wirklichkeit hat der Staat lediglich die Aufgabe, das öffentliche Gut der Finanzmarktstabilität dadurch zu sichern, dass keine systemischen Risiken bestehen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Rest muss dem Markt überlassen bleiben.
Ein neues staatliches Bewusstsein ist auch in der Fiskalpolitik notwendig. Die staatliche Verschuldung darf nicht weiter ausufern. Deshalb haben wir in Deutschland im Mai 2009 die Schuldenbremse ins Grundgesetz eingeführt, um die staatliche Neuverschuldung zurückzuführen. Richtig ist aber auch, dass die Haushaltsprobleme nicht allein mithilfe von Sparmaßnahmen gelöst werden können. Die zahlreichen Demonstrationen, die Europa während der Staatsschuldenkrise erschüttern, zeigen es deutlich: Haushaltskonsolidierung kann nur mit den Menschen geschehen, nicht dauerhaft gegen sie. Eine intelligente Haushaltspolitik setzt sich aus vier Elementen zusammen: Die Sicherung und Verbesserung der staatlichen Einnahmen, eine wachstumsfördernde Politik, die Reduzierung von rein konsumtiven Subventionen und eine Senkung der Ausgaben. Wachstumsorientierung meint in diesem Zusammenhang auch – besonders für Deutschland – die Binnenkonjunktur zu stärken und den Kapitalabfluss aus Exportüberschüssen ins Ausland zu verhindern.
Zusätzlich braucht es ein neues moralisches Bewusstsein dafür, dass Rendite endlich ist und nicht um jeden Preis und losgelöst von der so genannten Realwirtschaft erzielt werden kann. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die „dienende“ Funktion der Finanzmärkte, die nicht allein durch Gesetze, sondern vor allem auch durch eine moralische Verständigung aller Beteiligten zu erreichen ist. Und wir benötigen den Mut, besonders die Finanz- und Kapitalmärkte wieder stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben zu beteiligen als bisher. Für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist dies unerlässlich. Genau aus diesem Grund fordert die SPD eine Steuer auf Finanztransaktionen.
Und wir brauchen ein stärkeres Europa. Wie wir „mehr Europa“ schaffen können, dazu habe ich im Dezember 2010 einen Vorschlag veröffentlicht.1
5. Wir brauchen einen neuen Internationalismus
Auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise gab es mit dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20 in Pittsburgh 2009 eine gute Gelegenheit, erstmals eine internationale Verständigung über Regulierung und Aufsicht zu erzielen. Dieses „window of opportunity“ blieb aus mehreren Gründen weitgehend ungenutzt. Staaten wie Kanada vertraten die Meinung, die Finanzmarktkrise weder mit ausgelöst zu haben noch von ihr betroffen zu sein. Daher brauche es keinerlei neuer Regulierung. Diese Auffassung ist kurzsichtig, zugespitzt formuliert sogar protektionistisch.
Das Minimalziel muss daher lauten, zu einer neuen internationalen Verständigung, einem besseren Informationsaustausch und einem starken Frühwarnsystem zu kommen. Dazu muss auch gehören, internationale Regelkataloge wie ein derzeit diskutiertes Basel III-Abkommen oder die Bilanzierungsstandards allgemeinverbindlich zu machen und durch legitimierte Gremien erarbeiten zu lassen. Beispielsweise dürfen Bilanzierungsstandards nicht länger ohne die Beteiligung von Regierungen, kontrolliert durch die jeweiligen Parlamente, vereinbart werden.
Der Ausgangspunkt für diesen neuen Internationalismus kann nur die Europäische Union sein. Bedauerlicherweise hat die amtierende deutsche Bundesregierung in der Griechenland-Krise und während der Verhandlungen über den Stabilitätsmechanismus gezeigt, wie Diplomatie nicht funktioniert: Nicht nur lassen die vereinbarten Mechanismen zur Finanzmarktregulierung stark zu wünschen übrig, schlimmer noch: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit ihren Positionen Deutschland in Europa weitgehend isoliert.
1 Carsten Schneider, Die Lösung heißt Europa: Für ein verbindliches System der Verbundhaftung, in: Das Progressive Zentrum (Hrsg.): Welches Wachstum für Europa? Beiträge zur Zukunft des europäischen Modells, Berlin 2010.


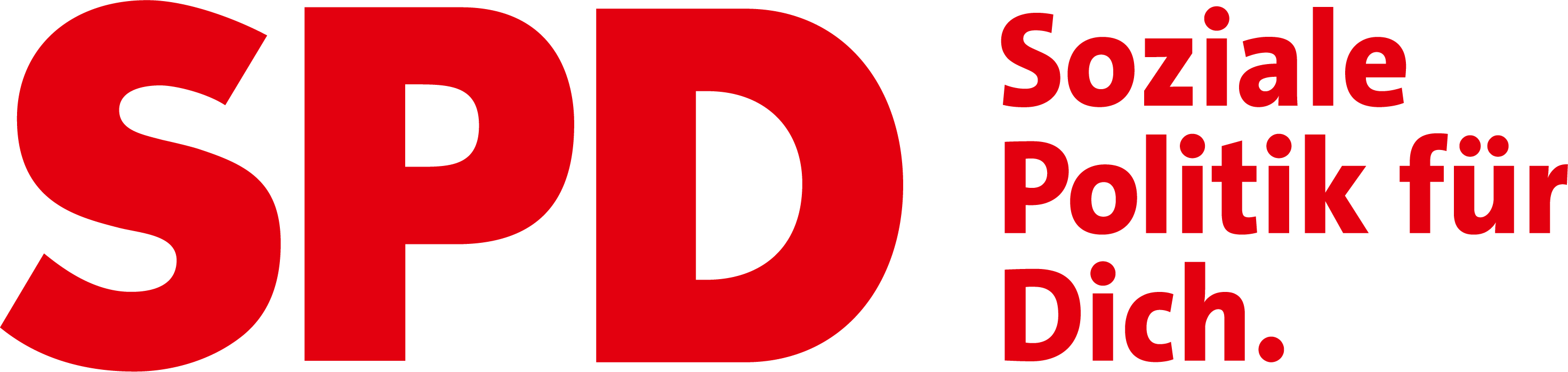
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!