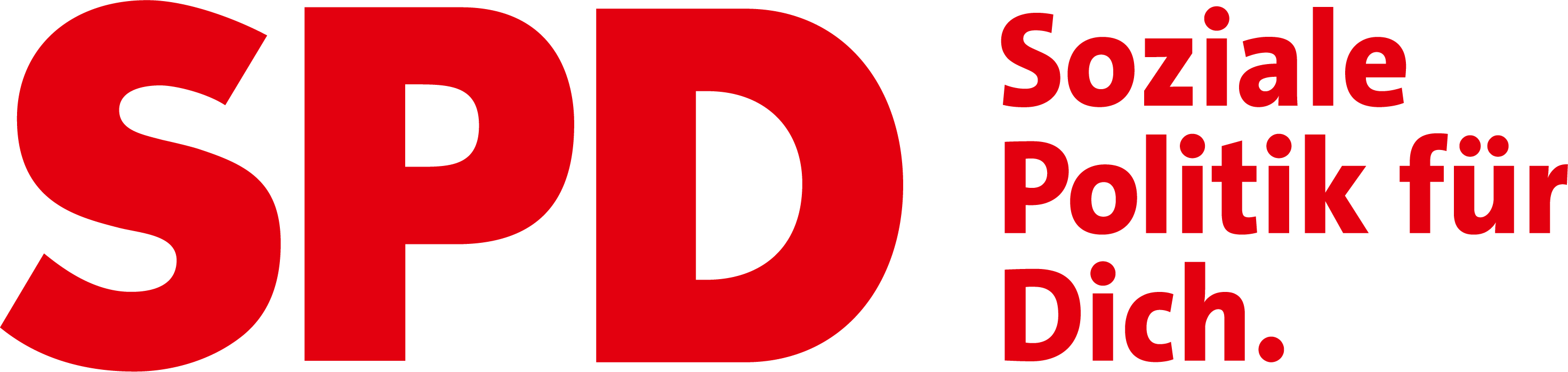Für den heutigen „DER HAUPTSTADTBRIEF“ habe ich folgenden Beitrag verfasst:
Was bringt Deutschland und seinen Unternehmen die Europäische Union? Politische Stabilität. Zusätzliches Wachstumspotenzial. Offene Märkte. Das ist ein Riesengewinn, den wir für Deutschland haben. Man kann es nicht oft genug sagen – denn wir vergessen es sonst allzu leicht. Nichtsdestotrotz: Was die Finanzpolitik betrifft und den Euro und die Unabhängigkeit der Nationalstaaten in ihrer Fiskalpolitik und die Trennung der Geld- und Fiskalpolitik – da, denke ich, sind noch etliche Hausaufgaben zu machen. Und da wird es nicht genügen, nur den Stabilitätspakt einzuhalten, und alles wird gut.
Die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB), in Deutschland immer sehr kritisch gesehen, war gut. Sie war sehr effizient – ökonomisch gesehen. Sie hat funktioniert. Aber deckt sich das auch mit der politischen Einschätzung? Nicht ganz. Denn die EZB muss ihre Unabhängigkeit wiedergewinnen. Sie ist nicht frei in ihren geldpolitischen Entscheidungen. Sie mischt sich in die Politik ein, und das ist nicht ihre Aufgabe. Sie hat nicht politische Vorgaben zu liefern, und auch nicht im Rahmen der Troika wirtschaftspolitische Empfehlungen zu geben.
Wie kann die Rückkehr zur geldpolitischen Unabhängigkeit verwirklicht werden? Ich denke nicht, dass wir noch mehr Vorgaben zu Papier bringen müssen, die im Zweifel politisch ausgelegt und entschieden werden. Die wichtige Frage wird sein, ob wir den notwendigen Schritt hin zu einer deutlich stärkeren Fiskalunion gehen werden. Der Fiskalvertrag wurde geschlossen, um – wie wir es in Deutschland mit der Schuldenbremse haben – in Europa Nationalstaaten stärker zu binden, als das über den Maastricht-Vertrag geregelt war.
Das heißt Steuerpolitik und Haushaltspolitik nicht mehr alleine im Deutschen Bundestag oder in der Assemblée Nationale zu entscheiden, sondern stärker koordiniert und auch sanktioniert durch eine europäische Institution. Wie das im Einzelnen vonstattengehen kann in einer EU der 28 – das ist eine offene Frage, die wir in den nächsten zwei Jahren, der Zeit, die uns die Zentralbank jetzt gekauft hat, klären und umsetzen müssen.
Da sind große Schritte zu machen hin zu einer Fiskalunion. Einige sind wir bereits gegangen. Wir haben nationale Souveränität abgegeben. Die großen Banken in Deutschland werden von der EZB zukünftig beaufsichtigt. Ich halte das für richtig in einem Binnenmarkt, der über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg gerade im Bankenbereich zu Verflechtungen geführt hat, die es unmöglich machen, eine große Bank wie beispielsweise die Deutsche Bank noch national zu kontrollieren, geschweige denn im Extremfall abzuwickeln.
Das Hin zu einer Fiskalunion bedeutet aber auch, die Steuerpolitik stärker zu koordinieren und zu vergemeinschaften – Beispiel Bankenabgabe, die wir schon haben. Das Volumen hier in Deutschland reicht nicht aus. Sie wird wahrscheinlich um das Dreifache steigen, um den Fonds bis Ende 2023 mit 55 Milliarden Euro zu füllen. Die spannende Frage ist: Ist diese Abgabe dann abzugsfähig von der Steuerschuld? In Deutschland ist das nicht der Fall. Dazu gibt es allerdings keine Regelung im Vertrag. Ich halte das für einen großen Fehler, denn ich kann mir schon kleinere Länder mit großem Bankensektor vorstellen, die die Bankenabgabe nicht steuerlich abzugsfähig machen werden. Dann wird der Druck auch in Deutschland steigen, sie nicht abzugsfähig zu machen. Das aber würde bedeuten, dass das Wort der Bundeskanzlerin „Wir werden nie wieder für die Verluste von Banken zahlen“ ad absurdum geführt würde – denn dann läge etwa ein Drittel der Kosten beim deutschen Steuerzahler.
Das heißt: Wir haben jetzt noch die Chance zur Korrektur. Wir dürfen in Europa die Steuerpolitik nicht für Wettbewerbszwecke missbrauchen lassen – mit Verlusten für die Allgemeinheit und im Endeffekt mit der Gefahr, dass uns die Ausgaben über den Kopf wachsen, die Steuerbelastung in Deutschland steigt. Deshalb sind auch Initiativen wie das vom Bundesfinanzminister schon in der vergangenen Legislaturperiode angestoßene „Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS) so wichtig, mit dem Ziel der Schließung von Steuerschlupflöchern legaler Art.
Es ist zur Zeit überall von der Währungsunion die Rede, aber kaum jemand spricht über die wirtschaftspolitische Koordinierung. Gerade sie scheint mir aber viel stärker in den Mittelpunkt zu gehören. Vorrangig ist doch, ob strukturelle Reformen tatsächlich stattfinden in den Ländern, so wie wir es in Deutschland Mitte der 2oooer-Jahre – und ich sage als Sozialdemokrat: zu Recht – gemacht haben. Wir hätten sonst dieses Wachstum nicht. Wir wären heute sonst auch nicht der Stabilitätsanker in Europa. Die Ernsthaftigkeit, sich in der öffentlichen Debatte damit auseinanderzusetzen, was von den Ankündigungen von Reformen in den Ländern wie Frankreich oder Italien tatsächlich umgesetzt wird, lässt zu wünschen übrig.
Es wird zu sehr auf die fiskalischen Zahlen gesehen und zu wenig auf die strukturellen Reformen geachtet. Auch das bedeutet eben einen Verzicht auf nationale Kompetenz. Und es wird sicherlich interessant werden, das mit den Franzosen und Italienern zu diskutieren – egal, ob sie Sozialisten oder Konservative sind.